 Das Haus
Das Haus
beheizte Wohnfläche: 166 m²
Gebäudenutzfläche (AN): 216 m²
Heizwärmebedarf: 78 kWh/(m²a)
(bezogen auf AN)
Anzahl der Bewohner: 2
Die Heizanlage
Heizleistung (B0/W35)*: 9,2 kW
Wärmequelle: Erdreich
(2 Erdsonden mit
160 m Gesamtlänge)
Wärmeverteilung: Fußbodenheizung
Anlagenbeschreibung
Zwei Erdsonden (2U) mit einer Gesamtlänge von 160 m erschließen das Erdreich als Wärmequelle für die Wärmepumpe. Der Wärmequellenkreis ist mit einem Wasser-Ethylenglykol-Gemisch (30%) gefüllt.
Die Wärmepumpe dient sowohl zur Gebäudebeheizung als auch zur Trinkwassererwärmung. Im Heizkreissystem ist ein Pufferspeicher (100L) installiert, der parallel zur Wärmepumpe angeschlossen. Die Beheizung der Räume erfolgt mittels Fußbodenheizung, wodurch nur geringe Heizkreistemperaturen erforderlich sind. Der Trinkwasserspeicher (185L) ist in dem Wärmepumpengehäuse integriert. Die eingebaute Zirkulationspumpe wird laut Planerunterlagen nicht genutzt.
In der Wärmepumpe ist - im gemeinsamen Vorlauf für TW-Erwärmung und Heizkreis - eine elektrische Zusatzheizung installiert.
Im Sommer kann die Anlage zur passiven Kühlung genutzt werden.
Ergebnisbeschreibung
Zeitraum Juli 2011 bis Juni 2012:
Die Jahresarbeitszahl dieser Wärmepumpen-anlage liegt mit 3,9 im Mittelfeld aller vermessenen Erdreich-Anlagen (Durchschnitt 4,0).
Negativ auf die Effizienz der Wärmepumpe wirkt sich die mittlere Betriebstemperatur während des "Heizbetriebes" (Beladung des Pufferspeichers) aus: mit 35,5°C liegt diese rund 3,5K über dem Durchschnitt. Die Wärmepumpe stellt 88% der gesamten Wärmemenge zur Raumheizung bereit (Durchschnitt: 80%). Damit fällt hinsichtlich des Einflusses der Wärmesenken-Temperaturen auf die Effizienz der Wärmepumpe weniger stark ins Gewicht, dass die mittlere Temperatur zur Beladung des Trinkwasserspeichers mit 44,5°C rund 3K geringer als der Durchschnittswert aller Anlagen ist.
Die Betriebstemperaturen der Wärmequelle liegen in der Kernheizperiode (Februar 2012) mit 6°C rund 2K über dem Durchschnittswert. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Arbeitszahl.
Negativ hingegen wirkt sich der hohe Elektroenergiebezug der Wärmequellen- Pumpe aus. Diese hat mit einem Anteil von 11,6% am Gesamtenergiebezug der Wärmepumpe (ohne Heizstab) den höchsten Elektroenergiebedarf aller untersuchten Anlagen (Durchschnittswert: 4,7%).
Die Betriebszeit der Wärmepumpe liegt mit 1620h/a im Mittelfeld.
Der Heizstab ist fast nie in Betrieb.
Die Möglichkeit der passiven Kühlung wurde nicht genutzt.
Hinweis:
Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu beachten, dass seit Ende März 2012 an einigen Tagen keine Messwerte der Soletemperatur vorliegen.
* ermittelt nach DIN EN 14511
|
|
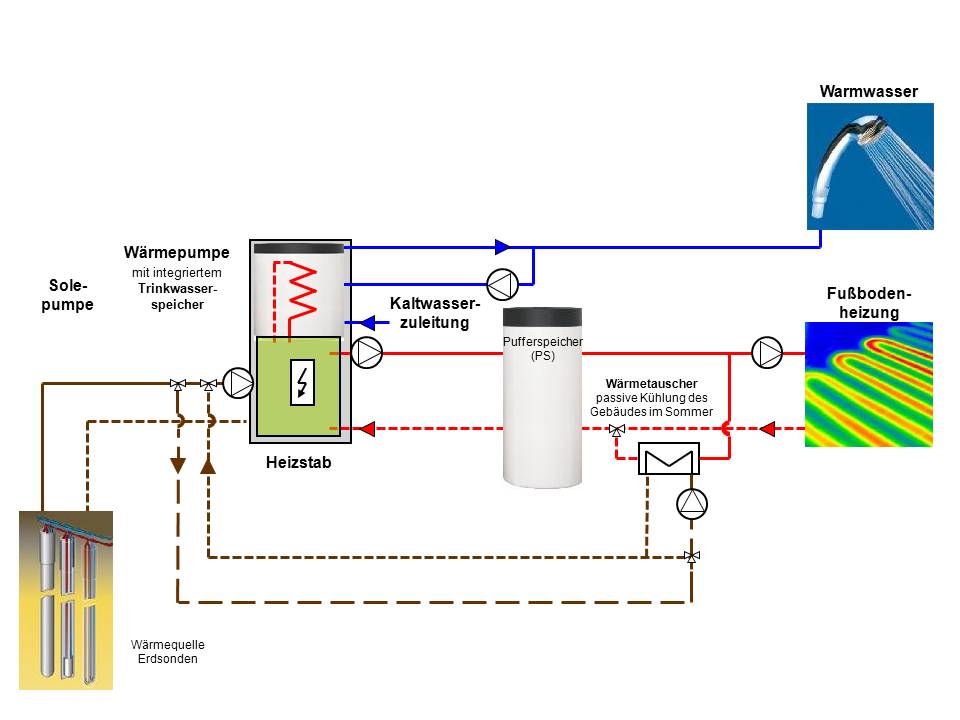 klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen
klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen
Energiebilanz und Arbeitszahlen:
 Wärmepumpe (Verdichter & Steuerung) Wärmepumpe (Verdichter & Steuerung)
 Solepumpe Solepumpe
 Heizstab Heizstab
 Heizung Heizung
 Warmwasser Warmwasser
 Arbeitszahl Arbeitszahl
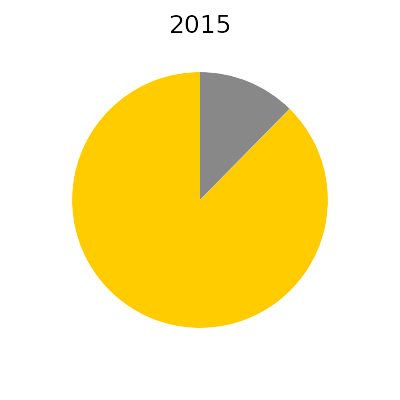
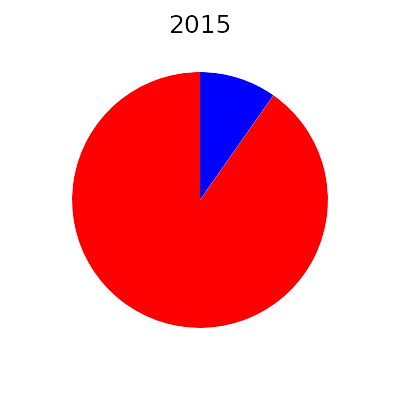
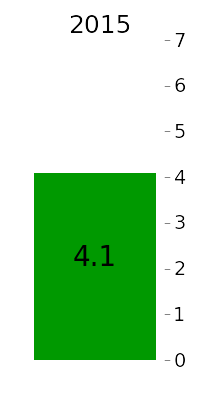
klicken Sie auf die Grafiken um die Monatswerte zu sehen
Mittlere Tagestemperaturen:
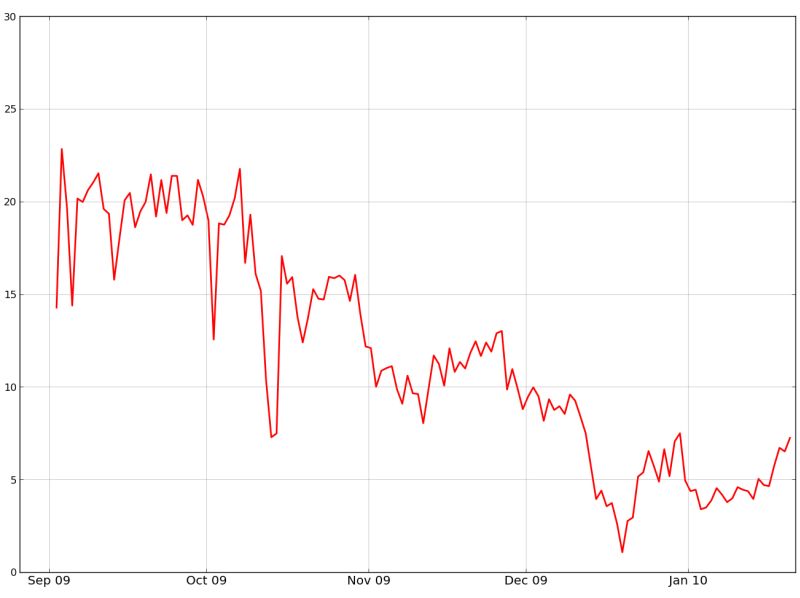

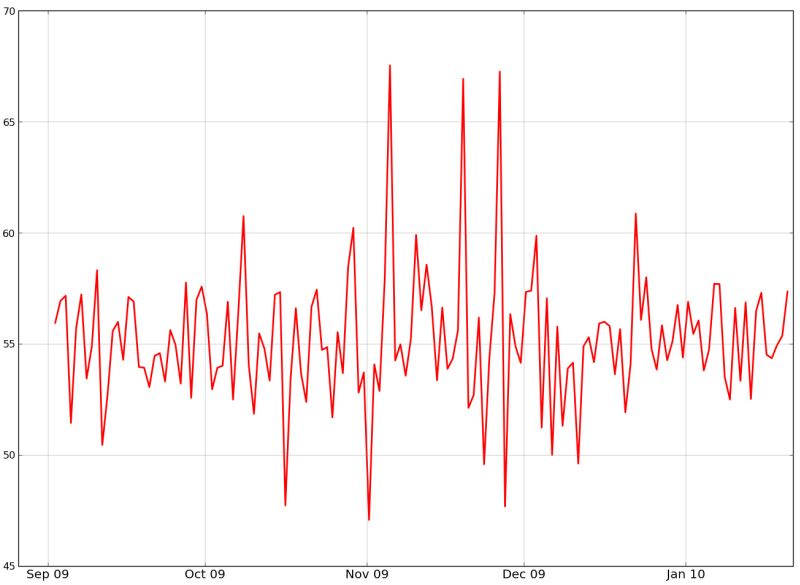 Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung
Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung
|
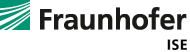
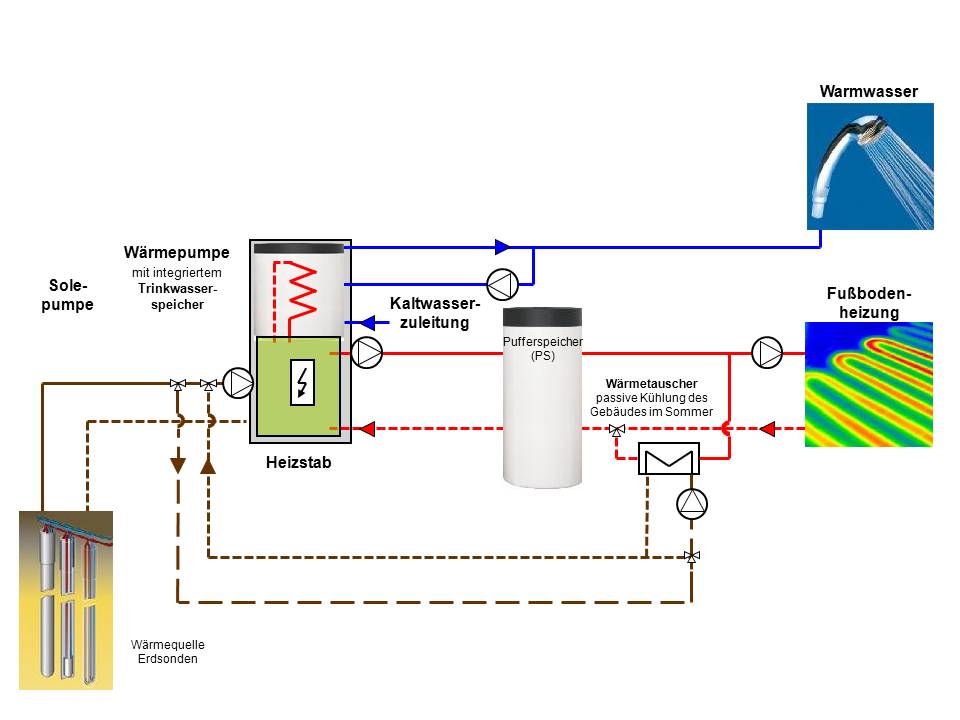 klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen
klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen
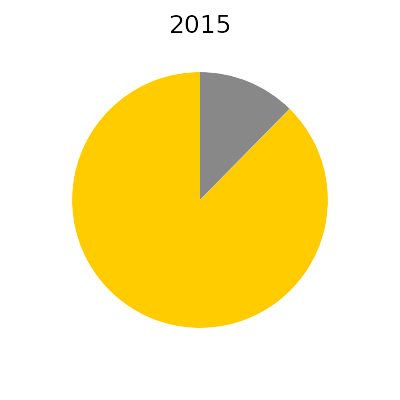
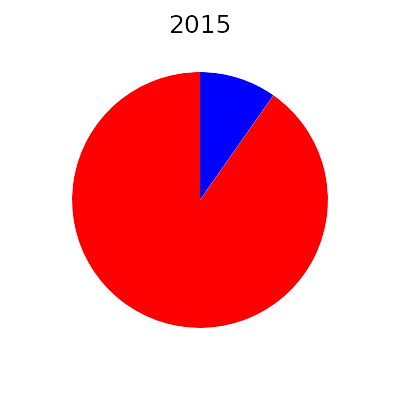
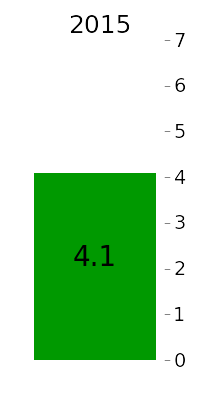
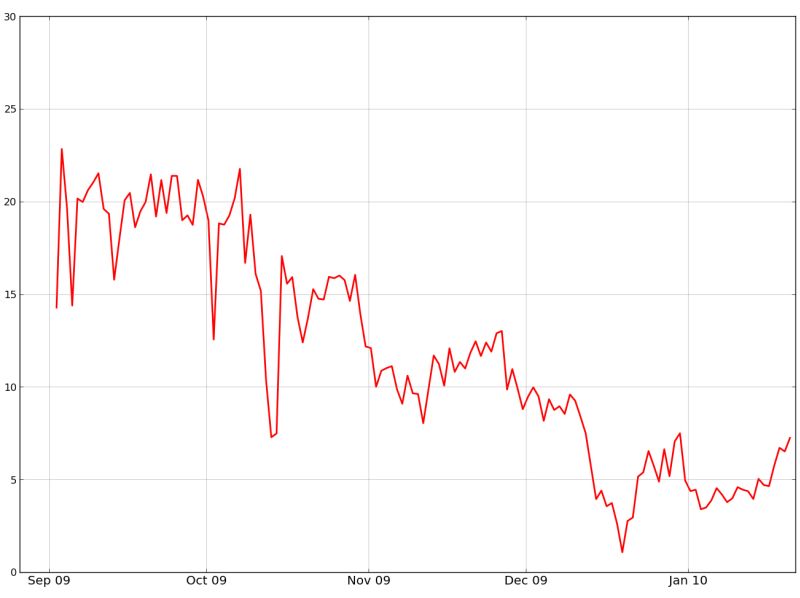

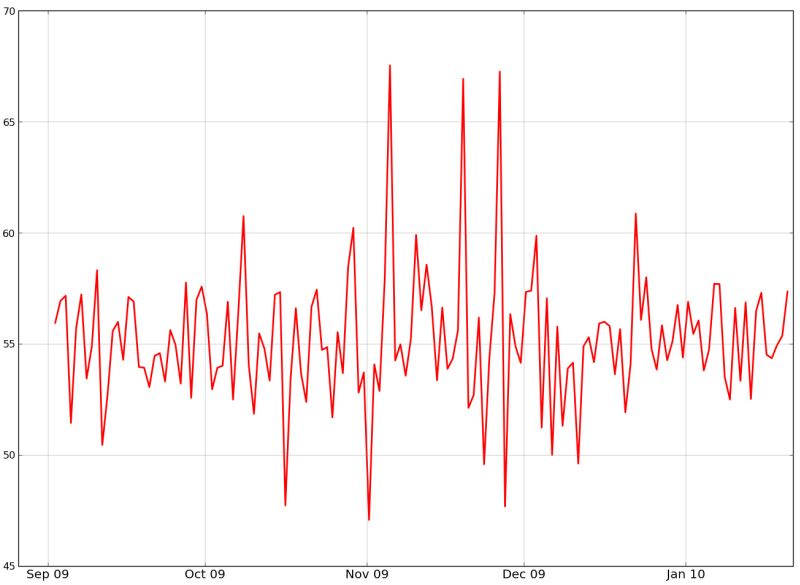 Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung
Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung